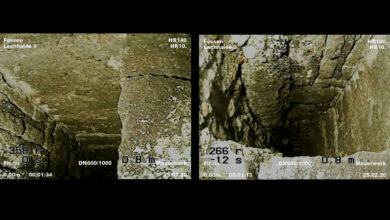Zuhause
Manchmal rede ich mir ein, niemand außer mir würde sie kennen: meine Lieblingsbank- die alte, dunkelbraune Holzbank. In unmittelbarer Nähe befindet sich auch dieser Garten,von dem ich wünschte, es wäre mein eigener. Ein Garten, wie er nicht schöner sein könnte. Wild bewachsen, inmitten alter Baumbestände, mit Stauden, Kletterrosen und großen Blüten. Wenn ich dort bin, fühlt es sich an, als wäre ich ein Stück weit angekommen. Ich werde ruhig und kann nachdenken, durchatmen, mich sammeln oder manchmal auch verlieren.
Ich habe dort viel Zeit verbracht: für mein Studium gelernt, unzählige Bücher gelesen, ich habe dort geweint, aber auch Tränen gelacht, gearbeitet, Musik gehört, gepicknickt, bin hochschwanger in der Sonne gelegen und barfuß durch die Wiese gelaufen.
Heute bin ich wieder hier, zurück auf meiner Bank. „Meine Bank”, so nenne ich sie. Früher dachte ich daran, ihr einen Namen zu geben. Ich dachte an Namen wie: „Else, Trude, Celeste oder Berti”. Aber weil ich mich nie für einen Namen entscheiden konnte, blieb es seither dabei, sie bei dem Namen zu nennen, der ausdrückt, was sie für mich war und ist. Eigentlich dachte ich, heute wäre einer dieser Tage, an dem ich hier bin, um ein bisschen Fracht abzuwerfen: Sorgen, Gedanken- das, was mich momentan eben umtreibt. Ich habe mein Buch dabei. Ich fühle mit Maria mit, die Wucht ihrer Gedanken reißt mich in ihren Bann. Und obwohl ich sie vor mir sehe, auf dem Weg laufend, kann ich mich nicht richtig auf Daniela Kriens Protagonistin konzentrieren.
Ich weiß nicht warum, aber ich denke immer wieder an den letzten Sommer. An das kleine Dorf und seine beschauliche, parkähnliche Fläche voll von Pinienbäumen, die sich am Meereshang aneinander reihten, wie Maiskolben auf dem Feld. Jugendliche sprangen von steilen Felsen des Hanges ins offene, blaue Meer. Ihre Schultaschen lagen auf dem staubigen Schotter oberhalb der steilen Treppe, die zu einem kleinen Steinplateau führte, von wo aus man über eine Leiter ins Meer steigen konnte. Dort unten saßen ältere Damen mit großen Hüten auf ihren gestreiften Klappstühlen dicht beieinander und aalten ihre haselnussbraun gefärbten, glänzenden Körper in der Sonne. Sie tranken gekühltes Ožujsko-Pivo aus einer Kühltasche und aßen Weißbrot und Tomaten. Sie redeten, aßen und im Hintergrund ließ eine von ihnen einen heimischen Radiosender auf ihrem Smartphone laufen, der hauptsächlich Folklore und Balkanpop spielte.
Ich sah die Frauen und die Jugendlichen. Für sie war dieser Ort ihr Ort. Das sah man. Und obwohl ich mich noch nie zuvor getraut hatte, von einem Felsen zu springen, wollte ich es diesmal schaffen. Wo ich normalerweise jedem vermeintlichen Risiko aus dem Weg ging, wollte ich es dieses eine Mal herausfordern. Oben am Felsrand angekommen, schaute ich runter – auf das tiefe Blau, auf die Jugendlichen im Wasser, auf die Frauen mit ihren Klappstühlen. Ich dachte an Situationen, in denen ich mir eingeredet hatte, nicht mutig genug gewesen zu sein. Aber dann – vielleicht war es die Sonne, vielleicht das Jubeln meiner Familien, vielleicht einfach nur dieser Moment – stieß ich mich ab und sprang. Die Sekunden in der Luft fühlten sich endlos an. Ein bisschen wie Segeln. Dann das Eintauchen, das salzige Wasser, das Brennen in meinen Augen. Ich tauchte auf und lachte laut. Ich war unbeschreiblich glücklich. Eine der Damen winkte mir mit ihrem Hut zu, als hätte sie genau darauf gewartet.
Jetzt, hier auf meiner Bank, verstehe ich, warum ich an diesen Moment denken muss. Dieser Ort hier – er ist für mich, was der Felsen am Meer für die Jugendlichen war, was die Steinplatten für die Damen sind.
Ein Ort, an dem ich zu Hause sein kann. An dem ich mich traue, loszulassen. Zu springen, auch wenn ich nicht weiß, wie tief das Wasser ist. „Meine Bank“ – vielleicht ist das ohnehin der schönste Name für sie. Sie kennt mich. Und ich kenne sie. Und manchmal, wenn man Glück hat, reicht das.